
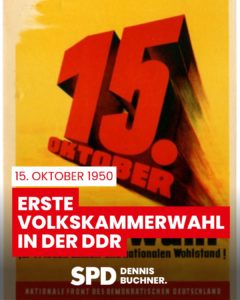
Am 7. Oktober 1949 wurde die Deutsche Demokratische Republik offiziell gegründet. Doch obwohl die DDR damit ein eigenes Parlament, die Volkskammer, benötigte, blieb dieses zunächst nur provisorisch: Die Abgeordneten stammten aus dem Volksrat, einer Art Übergangsgremium, und hatten keine direkte Legitimation durch die Bevölkerung. Erst über ein Jahr später, am 15. Oktober 1950, fanden die ersten Wahlen zur Volkskammer statt – ein deutlicher Hinweis auf die Diskrepanz zwischen Staatsgründung und demokratischer Legitimation.
Bereits im Vorfeld war klar, dass die Wahlen alles andere als frei und pluralistisch sein würden. Die SED hatte die Kandidaten in einer sogenannten „Einheitsliste“ zusammengestellt, auf der alle Abgeordneten festgeschrieben waren. Die Wahl war damit formal eine Abstimmung, tatsächlich jedoch ein Instrument der SED zur Festigung ihrer Kontrolle über das Parlament und die Landes- sowie Kommunalvertretungen.
Die zeitliche Verzögerung zwischen Gründung der DDR und der ersten Volkskammerwahl zeigt deutlich, dass die politische Macht von Beginn an zentralisiert und nicht vom Volk unmittelbar legitimiert wurde. Aus meiner Sicht als Sozialdemokrat bleibt dies ein mahnendes Beispiel dafür, wie wichtig echte, freie Wahlen für eine demokratische Gesellschaft sind. Ein Parlament, das seine Legitimation erst mehr als ein Jahr nach der Staatsgründung erhält, kann nur schwer als Ausdruck des Volkswillens verstanden werden.
Die Wahl von 1950 markierte also nicht nur den offiziellen Start der Volkskammer, sondern auch den Beginn eines Systems, in dem politische Mitbestimmung stark eingeschränkt war – ein entscheidender Unterschied zu den demokratischen Grundprinzipien, für die wir als SPD immer eintreten.
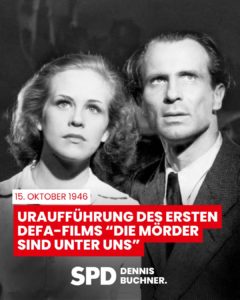
Heute vor 79 Jahren, am 15. Oktober 1946, erschien der erste DEFA-Film nach dem 2. Weltkrieg.
Im Rahmen unserer Reihe KinoGold hatte ich im Januar 2025 die besondere Freude, den historischen Film „Die Mörder sind unter uns“ im Kino Toni zu präsentieren. Dieser Film markiert ein einzigartiges Kapitel der deutschen Filmgeschichte: Als erste Nachkriegsproduktion der DEFA entstand er 1946 unter außergewöhnlich schwierigen Bedingungen.
Die Dreharbeiten begannen am 4. Mai 1946 – mitten in einem Berlin, das noch immer von den Zerstörungen des Krieges gezeichnet war. Zwei Wochen später, mit der Gründung der DEFA am 17. Mai 1946, konnten Besucher bei einer Festveranstaltung einen Blick hinter die Kulissen werfen und miterleben, wie hart die Arbeit an dieser ersten Produktion war. Außenaufnahmen zwischen den Trümmern der Stadt und improvisierte Sets zeigen eindrucksvoll die Herausforderungen, denen sich die Filmschaffenden stellten.
Inhaltlich erzählt der Film von einem Heimkehrer, der 1945 nach Berlin zurückkehrt und dort seinen ehemaligen Vorgesetzten wiedersieht – mittlerweile ein angesehener Geschäftsmann, dessen Taten während des Krieges grausame Spuren hinterlassen haben. „Die Mörder sind unter uns“ gehört damit zu den sogenannten Trümmerfilmen, die sich mit der unmittelbaren Nachkriegsrealität auseinandersetzen und die Frage nach Schuld und Verantwortung stellen.
Für mich als 1.Vorsitzenden des Fördervereins Kino Toni ist es immer wieder ein besonderes Erlebnis, solche filmhistorischen Schätze zu zeigen und mit unserem Publikum über ihre Bedeutung zu diskutieren. Der Film erinnert uns nicht nur an die Anfänge des deutschen Nachkriegsfilms, sondern auch daran, wie sehr Kunst und Gesellschaft in schwierigen Zeiten miteinander verwoben sind.
Im November 2025 starten mein Abgeordnetenkollege Tino Schopf und ich wieder mit der KinoGold-Reihe.
Nähere Informationen zu den neuen Filmen der KinoGold-Reihe: https://dennis-buchner.de/aktuelles/kiezspaziergaenge-kinogold-im-kino-toni/
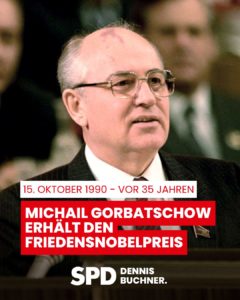
Am 15. Oktober 1990 erhielt Michail Gorbatschow den Friedensnobelpreis. Das Nobelkomitee in Oslo würdigte ihn für seine entscheidende Rolle im internationalen Friedensprozess und sein Engagement für Dialog, Abrüstung und Vertrauen zwischen Ost und West. Besonders seine Politik der Perestroika und Glasnost ebnete den Weg für politische Öffnung und Veränderung – auch in Europa.
Gorbatschow selbst bezeichnete die Auszeichnung damals als eine Anerkennung der schwierigen Reformen in seinem Land. Sein Wirken hat jedoch weit über die Grenzen der damaligen Sowjetunion hinaus gewirkt: Ohne seinen Mut zur Veränderung wäre die friedliche Revolution in Osteuropa, und damit auch die Wiedervereinigung Deutschlands, kaum möglich gewesen.
Berlin verdankt Michail Gorbatschow einen historischen Beitrag zur Freiheit und Einheit dieser Stadt. Als Zeichen des tiefen Respekts und der Dankbarkeit wurde ihm die Ehrenbürgerwürde Berlins verliehen – eine Auszeichnung, die seinen besonderen Platz in der Geschichte unserer Stadt unterstreicht.
Dennis Buchner, Vizepräsident des Abgeordnetenhauses von Berlin (SPD):
„Michail Gorbatschow hat mit seinem Mut zur Veränderung die Welt und unsere Stadt verändert. Berlin wird ihm immer ein ehrendes Andenken bewahren.“
Weitere Informationen: https://www.parlament-berlin.de/Das-Haus/Berliner-Ehrenbuerger/michail-sergejewitsch-gorbatschow
 Am 15. Oktober, dem Tag des Weißen Stocks, wird weltweit auf die Bedeutung von Selbstständigkeit, Mobilität und Teilhabe blinder und sehbehinderter Menschen aufmerksam gemacht. Der Tag erinnert uns daran, dass Inklusion eine gemeinsame Aufgabe ist, die uns alle betrifft.
Am 15. Oktober, dem Tag des Weißen Stocks, wird weltweit auf die Bedeutung von Selbstständigkeit, Mobilität und Teilhabe blinder und sehbehinderter Menschen aufmerksam gemacht. Der Tag erinnert uns daran, dass Inklusion eine gemeinsame Aufgabe ist, die uns alle betrifft.
Als sportpolitischer Sprecher setze ich mich in Berlin dafür ein, dass Sportangebote offen und zugänglich für alle sind – auch für Menschen mit Behinderungen. Doch Inklusion endet nicht auf dem Spielfeld: Sie beginnt im Alltag, auf dem Weg zur Arbeit, beim Einkaufen oder im digitalen Raum.
Der Weiße Stock steht als Symbol für Unabhängigkeit, Orientierung und Mut. Er mahnt uns, auf Barrieren aufmerksam zu machen – und sie Schritt für Schritt abzubauen. Dabei geht es nicht nur um bauliche Veränderungen, sondern auch um Bewusstseinsbildung und das Miteinander in unserer Stadt.
Gemeinsam können wir dafür sorgen, dass:
öffentliche Räume und Verkehrssysteme sicher und gut zugänglich gestaltet werden,
digitale Angebote für alle Menschen nutzbar sind,
Hilfs- und Unterstützungsangebote Menschen mit Sehbeeinträchtigungen den Alltag erleichtern,
und inklusive Sport- und Freizeitmöglichkeiten Begegnung und Teilhabe fördern.
Der Tag des Weißen Stocks erinnert uns daran, wie wichtig gegenseitiges Verständnis, Rücksicht und Solidarität sind – damit Berlin eine Stadt bleibt, in der alle Menschen selbstbestimmt leben können.

Mit der gestrigen Ausgabe vom 13. Oktober 2025 ist ein Kapitel Berliner Sportgeschichte zu Ende gegangen: Nach über 102 Jahren erscheint die traditionsreiche Wochenzeitung „Fußball-Woche“ (FuWo) nicht mehr.
Als sportpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus bedauere ich diese Entscheidung zutiefst. Die „FuWo“ war über ein Jahrhundert hinweg mehr als nur ein Sportmagazin – sie war Chronistin, Forum und Stimme des Berliner Fußballs in all seinen Facetten.
Seit ihrer Gründung im Jahr 1923 hat die „Fußball-Woche“ Generationen von Berlinerinnen und Berlinern begleitet – durch Kriegsjahre, Teilung, Wiedervereinigung und den tiefgreifenden Wandel der Medienlandschaft. Sie war immer dort präsent, wo Fußball gelebt wurde: auf den großen Plätzen der Stadt, aber auch auf den kleinen Nebenfeldern, wo Ehrenamt und Leidenschaft den Sport tragen.
Ob Hertha, Union, Tennis Borussia, SV Empor oder der FC Spandau – die „FuWo“ war stets nah dran. Sie hat die großen Geschichten erzählt, aber vor allem die kleinen nicht vergessen.
Das Aus der „FuWo“ ist ein Schlag für den lokalen Sportjournalismus. Die wirtschaftlichen Herausforderungen, die zur Einstellung geführt haben, zeigen, wie schwer es unabhängige Medien derzeit haben – gerade jene, die sich der Breite des Sports widmen und nicht nur dem professionellen Spitzenfußball.
Mit der „FuWo“ verliert Berlin nicht nur eine Zeitung, sondern auch ein Stück lokale Identität und sportliche Erinnerungskultur.
Als Sportpolitiker möchte ich deutlich sagen: Der Wert des lokalen Sportjournalismus darf nicht unterschätzt werden.
Wir brauchen Formate, die die Vielfalt des Berliner Sports sichtbar machen – von der Kreisliga bis zur Champions League, vom Nachwuchs bis zu den Traditionsvereinen.
Ich danke allen Journalistinnen und Journalisten, Redakteurinnen und Redakteuren, die die „FuWo“ über Jahrzehnte geprägt haben. Ihr Engagement hat den Berliner Fußball lebendig gehalten – Woche für Woche, über Generationen hinweg.
SPD Prenzlauer Berg NO/SPD Bötzowviertel: Vorstellung der weiblichen und diversen Kandidaturen
16.10.2025, 19:00 Uhr
Seniorenstiftung Prenzlauer Berg Gürtelstraße 33, 10409 Berlin
Stammtisch der SPD Mauerpark
16.10.2025, 19:30 Uhr
Bornholmer Hütte, Bornholmer Str. 89, 10439 Berlin
Mobile Sprechstunde Tino Schopf
18.10.2025, 10:00 Uhr - 12:00 Uhr
Arnswalder Platz